Jetzt auch als eBook
Das lange vergriffene und vermisste Buch ist im Dezember 2020 endlich als eBook erschienen. Im Verlag SAGA Egmont, Kopenhagen, original und ungekürzt, aber mit dem neuen Titel “Mensch in Menschenmassen” und neuem Titelbild. Zum attraktiv niedrigen Preis von 5,99 € inklusive MWSt bei allen Online-Buchversendern im Lieferprogramm und auf allen Geräten zu lesen (PC, Laptop, Tablet, Smartphone, Reader).
Walter Laufenberg, der als „Lästerer vom Dienst“ bekannte Herausgeber des Online-Wochenmagazins www.netzine.de, richtet den Blick diesmal auf sich und seinesgleichen, nämlich auf Menschen, die gern und viel herumreisen. Die Hauptfigur dieses amüsanten Romans, der zwischen Abenteuerroman und Liebesroman changiert, ist ein Reiseleiter, der sich Happy nennen läßt, von seiner Freundin aber Odysseus genannt wird. Tatsächlich ist er, solange es mit den Frauen klappt, mehr Happy als ein strahlender Held.
Eine Chinareise voll von überraschenden, authentischen Beobachtungen macht die rasante Entwicklung deutlich, die China gegen Ende des vergangenen Jahrhunderts erlebt hat. Gleichzeitig wird diese Rundreise für die Leser durch die Erinnerungen, die sich dem Reiseleiter aufdrängen, zu einer grandiosen Tour d’horizon.
Die Reisebekanntschaften, die die Reisenden dabei machen, kommen ihnen wie alte Bekannte vor. Was daran liegt, daß man selbst nicht anders ist als die Leute, die hier mit süffisantem Lächeln und köstlich frechem Vokabular gezeichnet werden. Der Autor, ein routinierter Erzähler, kennt die Welt, und er kennt seine Mitmenschen. So ist ein moderner Gesellschaftsroman entstanden, der das Heute einmal nicht aus der Perspektive eines Provinznestes zeigt, wie so oft in der Literatur vorgeführt. Hier ist es die Fremde, die entlarvend wirkt.
Womit die alte Volksweisheit bestätigt wird: Um einen Menschen wirklich zu kennen, muss man mit ihm ein Fass Salz verzehrt oder eine gemeinsame Reise gemacht haben. Also denn!
Leseprobe:
1.
Ein kehliges Grunzen, ein lauter werdendes Brummen. So stand er da, der Jumbo. Unwillig, unentschlossen. Und wie gegen alle Welt anmurrend. Stand da in einem heftigen Vibrieren. Als ob alle vierhundertsechzig Menschen an Bord diesen einen Gedanken zitterten: Das kann nicht gutgehen.
Ein Zittern, das immer wieder neu anflutete und gleich darauf abebbte. An und ab, nervenzerrend, so schüttelte es den Jet. Auf der Startbahn des Flughafens von Hongkong. Abflugbereit. Aber im rabiaten Griff des Taifuns.
Warten auf den Ratschluß der Fluggötter in Cockpit und Tower. Warten. Was bleibt einem anderes übrig. Und all seine Zuversicht, all seine Hoffnung auf die setzen, die über Sein oder Nichtsein entscheiden. Die unbekannten Olympischen, weder mit Gebeten ansprechbar noch durch Opfer günstig zu stimmen. Nur mit geduldigem Warten zu verehren.
Es ist Freitag, der 20. August, und es geht mal wieder um beinahe nichts und doch um Leben oder Tod �
�� das ist so menschlich. Wird die Starterlaubnis erteilt oder müssen wir wieder aussteigen? Das ist die Frage. Vielleicht doch besser, sich wieder hineinverrenken zu müssen in die Regenhäute, die von der Fluggesellschaft verteilt worden waren. Damit man nicht auf den paar Metern die Gangway hinauf völlig durchnäßt würde. Und dann wieder herumzustehen, wie sie vorher herumgestanden hatten, im Warteraum, einige Hundertschaften Heimkehrer, alle eingehüllt in den Regenschutz der Cathay Pacific, transparent und knöchellang und mit Kapuze. So gleichgemacht wie provisorisch verpackte Leichen.
Penni hatte wieder bei dem mit dem heruntergezogenen Schnäuzer gestanden. Mit diesem Hufeisenbärtchen. Soll wohl als Glückssymbol dienen. Hilft ihm jetzt aber auch nicht mehr. Gibt seinem Gesicht nur den blasierten Ausdruck der High Snobiety. Penni hat es also auch in dieser Situation nicht über sich gebracht, wieder an meiner Seite zu sein. Keine Versöhnung, kein Wort, das eine Brücke baut, nicht wenigstens ein Blick zu mir herüber, auch nicht im Angesicht des … Nein, nein, ich will es nicht einmal denken. Jedenfalls jammerschade um sie. Eine Frau wie Penni, so einmalig, neben ihr sind alle anderen, die ich gehabt habe, nur als Komparserie aufgetreten. Um sie desto großartiger dastehen zu lassen.
Kaum in der Maschine, hatten die Stewardessen ihnen geholfen, sich das Kunststoffzeug hastig vom Körper zu reißen. Und hatten sie weitergeschoben. “Schnell durchgehen bitte, Platz machen für die Nächsten!”
Aber jetzt zurück in die Wartehalle? Noch einmal diese umständliche Prozedur? Noch länger auf den Heimflug warten?
Bedeutete jede Minute Verzögerung doch, daß das Auge des Taifuns näherkam. Starttermin für den Flug CX 289 war laut Timetable 22 Uhr 40. Zwischen 23.00 und 24.00 Uhr, so der Wetterbericht im Hongkonger Fernsehen, wird der Taifun “Tasha”, von Südosten kommend, die Stadt erreichen. Und nun schon eine halbe Stunde über der Zeit und offenbar im-mer noch keine Starterlaubnis. Nur dieses Zitterrütteln.
Da endlich tobten die Triebwerke los. Daß kein Wort mehr zu verstehen war, kein Ton mehr von der Beruhigungsmusik aus den Lautsprechern. Und dieses Vibrieren plötzlich noch viel unangenehmer. Ein heftiges Zittern, dessen man sich doch nicht zu schämen brauchte. Weil es in allen war.
Also Abflug. Im Taifun. Sie riskieren es. Sie riskieren unser Leben. Wahnsinn! Die Maschine beschleunigte unheimlich schnell. Und sie hob ab, stieß schräg in den dunklen Himmel. Selbstbewußt und zielstrebig, allem Rütteln und Schaukeln zum Trotz. Was ihn ein wenig ruhiger werden ließ. Er konnte ja nicht ahnen, wo sie ihn hintragen würde.
Auf dem Bildschirm erschien das Flugzeug, nach halblinks oben gerichtet, und der Pfeil, der den Sturm anzeigte, kam von halbrechts unten. Windgeschwindigkeit 110 km/h, stand da. Aber Rückenwind. Also doch noch einigermaßen pünktlich heimkommen. Wenn nicht der Taifun uns aus dem Himmel schüttelt, wie wir früher die Äpfel aus dem Straßenbaum geschüttelt haben. Wie haben wir sie runterprasseln lassen. Weit verstreut. Und zermatscht. Was war uns schon ein Apfel? Was sind wir dem Sturm? Plötzlich – wie wertlos all die Reisemitbringsel, die vielen Filme, alles Neue, das wir gesehen, das Unerhörte, das wir gehört haben. Souvenirs, Souvenirs, der schöne Schaum der Ewigkeit von Flut und Ebbe, neuer Flut, neuer Ebbe. Und sogar ein nie zuvor gedachter Gedanke: wertlos. Wie das bißchen Veränderung des Weltbilds, dieses stolzneue Bewußtsein. Wie belanglos alles, wenn die Formen zerstört sind.
Und wenn das nun das Ende sein sollte – okay. Was habe ich denn noch zu verlieren? Ich, der ich alles falschgemacht habe. Wenn der Taifun uns zerschmettert, erspart mir das, selbst Hand an mich zu legen.
Schon bei der Ankunft der Gruppe aus China in Hongkong am Tag zuvor, nach der schikanös-langwierigen Einreisekontrolle im Bahnhof, hatte der örtliche Reiseleiter vom Taifun gesprochen: Windstärke 3. So stand es dann auch im Hotel auf dem Schild mit Kartenausschnitt und einem dicken roten Pfeil, der die Marschrichtung von “Tasha” anzeigte. Heute am späten Nachmittag noch waren einige aus der Gruppe mit der letzten Fähre gefahren. Kein anderes Schiff mehr unterwegs auf dem wildgewordenen Wasserarm zwischen Kowloon und der Viktoria-Insel. Auf dem hochgehenden Geschäume nur ein Polizeiboot, das mit seinen Lautsprechern gegen den Sturm anbrüllte: “Sofort die Strandpromenade verlassen!” Damit es die Leute nicht ins Meer weht. Einzelne Furchtlose gingen trotzig weiter, in so krasser Schräglage, wie sie ohne den Wind niemals möglich wäre. Was sie belustigte, sie verleitete, mit dem Sturm zu spielen. Und er selbst war einer von diesen Unerschrockenen. War ihm doch inzwischen alles egal. Immer wieder plötzliche Regenschüttungen, gegen die es keinen Schutz gab. In den Papierkörben zerfetzte Regenschirme. Die Wolkenkratzer am anderen Ufer verschwanden minutenlang in schwertriefenden Wolken wie unter Tarnkappen und leuchteten gleich darauf schweißglänzend wieder auf, so strahlend, als atmeten sie einmal kräftig durch: Nochmal gutgegangen. Das hatten seine Leute ja alles noch als recht amüsant empfunden.
Doch die Hotels, Restaurants und Läden waren plötzlich nicht mehr wiederzuerkennen. Eine Stadt wie im Krieg. Überall schwere Eisenrollos herabgelassen. Und wo es keine gab, wo Fensterscheiben ungeschützt dem Unwetter ausgesetzt waren, da hatte man sie kreuzweise mit roten Streifen beklebt. Wie nach Moses und Aarons Weisung mit einem blutigen Kreuz dem rächenden Gott signalisiert: Dieses Haus verschone, denn hier wohnt einer aus deinem auserwählten Volk. Der Schiffsingenieur hatte es besser gewußt: “So beklebt können die Scheiben nicht so leicht vom Sturm eingedrückt werden. Das macht einige Kilopond Unterschied.” Ein Livrierter hatte vor dem verrammelten Haupteingang des New World Hotel gestanden und sie auf einem Schleichweg durch eine stillgelegte Ladenpassage hintenherum hineingeführt. Da hatte die Tafel in der Lobby bereits Windstärke 8 angezeigt. Der rote Pfeil war der Stadt gefährlich nahegerückt. Und keine Chance, dem Unheil zu entgehen. Die Koffer waren unterwegs zum Flughafen, die Zimmer längst von neuen Gästen bezogen.
Happy zeigte sich von all dem nicht berührt. Auch “Tasha” brachte es nicht fertig, ihn aus der Ruhe zu bringen. Aber diese Ruhe war nicht seine gewöhnliche Gelassenheit, seine Allzeitbereitschaft zu Witzeleien. Einige aus der Gruppe sahen es genauer: Das war eher Resignation. Wenn ich erst wieder zuhause bin, überlegte Happy, ja, wenn überhaupt, dann werde ich mich jedenfalls nur noch mit Pflanzen umgeben. Sträucher und Blumen als mein Gegenüber. Daß sie mich mit ihrer unendlichen Geduld anstecken. Diese Gleichgültigkeit des Grünzeugs gegenüber den Menschen, dieses auf sich selbst Konzentriertsein. Beneidenswert. Wie hatte der pensionierte Richter ihm am Nachmittag gesagt: “Sie sehen aus, als wären Sie des Handelns müde, als hätten Sie nur noch Lust zum Denken.” Und hatte dann noch erklärt: “Das ist ein Zitat von André Gide. Muß für Sie als Literaturwissenschaftler ja wohl bekannt sein.”
Müde ja, und nicht nur das, hatte er gedacht – und nicht gesagt. Er hatte genug von den Leuten. Vier Wochen diese Menschen um sich, Tag und Nacht, das war mehr als genug, war unerträglich. Dabei sind sie nicht schlimmer gewesen als die in anderen Gruppen, mußte er sich zugeben. Die meisten wenigstens. Aber mit jeder neuen Gruppe das gleiche: Immer wieder neue Menschen und doch kaum mal was Neues. Immer nur Leute. Und gegen Ende der Reise dann dieses Gefühl, man könne es nicht mehr ertragen. Weil aller Reiz des Neuen dahinschmilzt wie Eis in der Sonne. Was da übrigbleibt, das ist die immer gleiche Unansehnlichkeit. Die meisten schonungslos alt und häßlich. Daß sie sich nicht zuhause verstecken. Ab dreißig ist man für sein Gesicht verantwortlich, sagte er sich manches Mal schaudernd. Anfangs, als er noch neugierig auf Frauen gewesen war, als er nur immer die Gelegenheit und dann den Punkt gesucht hatte, der sie tanzen ließ, als sein frischaufgedrehtes Spielzeug, damals hatten ihn die zerstörten Gesichter nicht gestört. Überhaupt nicht gesehen. Erst seit wenigen Jahren war das Dilemma für ihn sichtbar – und seitdem unübersehbar: Die schmalkniffigen Münder, die zerfingerten Nasen, die lichtlosen Augen. Und da meinten diese Frauen immer noch, in den einschlägigen Magazinen einschlägige Tips finden zu können gegen kleine Schönheitsfehlerchen: Gegen lose Haut unterm Kinn und Fältchen um die Augen und rote Ohren und für feineren Schwung der Augenbrauen, zur Kräftigung der Fingernägel. Einfach lachhaft. Und die Dreistigkeit, sich einem jungen Menschen, einem Mann in den besten Jahren so zu präsentieren. Wenn sie wenigstens Eleganz gezeigt hätten. Aber nein. Oder wenigstens die Schönwürde des Alters. Aber auch das nicht. Nur immer diese untauglichen Versuche, in den Jungbrunnen zu springen. Und diese flachgehende Neugier und gelangweilte Konsumlust. Und trotz alledem der unstillbare Wunsch nach einem Aufflackern in den Augen des Reiseleiters. Und dann dieses Sonder-Angebot von gestern nachmittag, das …

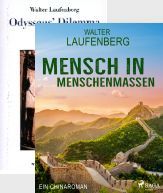











































 Der Computer Doktor in Mannheim
Der Computer Doktor in Mannheim