Der erste Johannes XXIII. und was die Steine über einen Verdammten verraten
Drei Päpste sind zwei zuviel. Der so gebildete wie gerissene Baldassare Cossa, offiziell gewählter Papst Johannes XXIII., schmiedet einen Plan, wie er seine beiden Widersacher ausstechen kann. Damit er diesen Plan umsetzen kann, ruft er das Konstanzer Konzil ins Leben. Es soll die Krönung seiner Laufbahn werden. Doch für Baldassare Cossa endet es im Fiasko.
Das faszinierende Intrigenspiel mit und um Papst Johannes XXIII. liegt jetzt 600 Jahre zurück und wird groß gefeiert: Man hat ihn jahrelang im Kerker gehalten, den lebensfrohen und so tüchtigen Neapolitaner Baldassare Cossa. In der Zollburg Eichelsheim, die nahe Heidelberg zwischen Stromkilometer 423 und 424 am Rheinufer stand. Nur gegen ein hohes Lösegeld ließ man ihn nach beinahe vier Jahren frei. Aber dann ist er noch im selben Jahr ins Grab gelegt worden, vermutlich von Mörderhand umgebracht.
Er war in ordentlichem Verfahren zum Papst gewählt worden. Als Johannes XXIII. hatte er im Jahre 1414 das Konstanzer Konzil ins Leben gerufen und zunächst auch geleitet. Während des Konzils dankte er ab, um das Große Abendländische Schisma zu beenden, wurde dann aber aus fadenscheinigen Gründen gefangen gesetzt. Die Kirche beschloss ab da, so zu tun, als hätte es den Mann, der ihr fünf Jahre lang als Papst treu gedient hatte, nie gegeben, so dass sich im 20. Jahrhundert ein weiterer Papst mit dem Namen Johannes XXIII. schmücken konnte.
Mit diesem biografischen Roman wird der unterschlagene erste Namensträger ins Leben zurückgeholt. Eine imponierende Persönlichkeit, so gebildet und genussfreudig, aber auch so gerissen und skrupellos, wie im chaotischen Spätmittelalter sein musste, wer unter den Großen mitmischen wollte.
L E S E P R O B E:
1.
Das Oberste Gericht der Signoria Firenze stand so unnahbar hoch über dem gemeinen Volk der Stadtrepublik Florenz, dass es bei den kleinen Leuten ein besonderes Vertrauen genoss. So absurd kann das Verhältnis von über und unter sich zeigen. Die beiden Delinquenten, über die das Oberste Gericht jetzt im hohen Saal sein Urteil finden wollte, waren keine Bürger der Republik. Umso kleiner wirkten die beiden Männer. So klein, dass es zum Erbarmen war, zumindest gewesen wäre, aber sie waren ja Fremde. Man hielt sie in gehörigem Abstand von dem auf erhöhtem Podest stehenden Richtertisch, hinter dem die Hoheit ausstrahlenden, würdig dekorierten drei Richter in stocksteifer Haltung saßen. Die beiden Angeklagten standen unten im Saal hinter einer hölzernen Barriere, die rechts und links von bewaffneten Soldaten flankiert wurde. Stumm und starr hielten sie sich dort mühsam aufrecht, gesenkten Hauptes, in knittriger Sträflingskleidung.
Ihre Hände waren vorsichtshalber auf dem Rücken mit kurzen Kälberstricken zusammengebunden.
Gerade eben waren ihre Namen verlesen worden, dazu die persönlichen Angaben, soweit sie dem Gericht bekannt waren: „Yiangos di Kriti, 38 Jahre alt, Schafhirte, und Anastasassis di Kriti, 33 Jahre alt, Schiffer. Beide ledig und ohne Verwandtschaft in der Republik Florenz oder im näheren Ausland.“
Der Vorsitzende Richter hatte die Angeklagten gefragt, ob diese Angaben stimmten. Und die Angeklagten hatten wie aus einem Mund geantwortet: „Ja.“
Auf die nachfolgende Frage des Richters, ob sie zu diesen Angaben noch Ergänzungen zu bringen hätten, kam ebenso gleichzeitig die Antwort: „Nein.“ Womit für jeden im Zuschauerraum klar war: Die Angeklagten haben sich in ihr Schicksal ergeben, weil sie keine Chance mehr sehen, mit heiler Haut davon zu kommen. Und sie wollen auf keinen Fall noch einmal einem hochnotpeinlichen Verhör unterworfen werden.
Dann trat auch schon der Ankläger auf. Ein Schönling im besten Mannesalter stieg übertrieben agil auf die an der rechten Seite stehende, etwas erhöhte Kanzel. Kaum hatte er sein wallendes Haar mit herrischer Geste zurückgestrichen, zeigte er mit spitzem Zeigefinger am ausgestreckten rechten Arm auf die beiden Angeklagten.
„So sehen nicht die Werkzeuge unseres erhabenen Gottes aus“, rief er in den Saal, „so sieht auch nicht aus, was Fortuna, die Glücksgöttin, möglicherweise das Idol dieser ungläubigen Verbrecher, aus ihrem Füllhorn über der Menschheit ausgießt. Nein, so sieht das Geschmeiß aus, das Satan, der Herr der Fliegen, auf uns losgelassen hat. Damit wir das Leben als ein Vegetieren im Jammertal empfinden. Damit unser täglicher Lobgesang auf Gott verstumme. Damit wir vergessen, was unsere vornehmste Pflicht ist, nämlich die Erde von solchem Geschmeiß zu befreien!“
Nach einer Kunstpause, in der er umherschaute, um den stummen Beifall aller Anwesenden zu kassieren, dieses freundlich zustimmende Nicken, auch die geschürzten Lippen, die gierig blitzenden Augen, das Zähneknirschen, setzte der Ankläger neu an: „Diese beiden Ausländer haben sich unter Angabe falscher Namen und falscher Berufsbezeichnungen in den Palast unseres hoch verehrten Bischofs, des Kardinalbischofs von Tusculum, eingeschlichen und dort sehr gezielt und schnell Kontakt zum Leiter des Küchenpersonals aufgenommen. Als angeblicher Hilfskoch hat der Angeklagte Yiangos di Kriti schon bald eine Schlüsselstellung im Bischofspalast eingenommen, während der Angeklagte Anastasassis di Kriti eine ähnlich wichtige Rolle beim Kellermeister spielte. Damit haben die beiden Verbrecher die Vorbedingungen für die Untat geschaffen, zu der sie sich verschworen hatten. Wer und was sie zu diesem Verbrechen getrieben hat, das war von den beiden verstockten Tätern bis jetzt noch nicht zu erfahren, nicht einmal unter der Folter. Doch für uns wichtiger als die Motivation zur Tat ist das Ergebnis dieser Freveltat. Das bemitleidenswerte Opfer ihres hinterhältigen Anschlags, den hoch verehrten Kardinalbischof von Tusculum und Dekan des Kardinalskollegiums, Baldassare Cossa, den diese beiden Verbrecher vergiftet haben, mussten wir im vergangenen Jahr zu Grabe tragen. Friede seiner Asche! Aber sein Tod schreit nach Rache. Sein Blut komme über die beiden Attentäter, die ihr Verbrechen gestanden haben, und deren Tod ich deshalb fordere, als die einzig gerechte Sühne für ihre schreckliche Tat.“
Eine Anklagerede, an altlateinischer Rhetorik geschult, die erschauern ließ. Die konsequente Forderung der Todesstrafe stieß bei den Zuhörern auf Genugtuung, wie man ungeniert zeigte. Ein allgemeines Aufstöhnen, einzelne Bravo-Rufe, heftiges Nicken, Füße scharrten und trampelten. Das Rachebedürfnis verriet sich unverhüllt.
Das war die andere Seite der aufrichtigen Trauer um den verehrten Toten. So begeistert war man in Florenz von dem Kardinalbischof Baldassare Cossa gewesen. Von dem Mann, der schon früher, in den sieben Jahren, in denen er als Kardinalslegat in Bologna tätig war, sich als ein vorbildlicher Regent erwiesen hatte, dem Bologna eine neue Ordnung und Sicherheit und einen aufblühenden Wohlstand verdankte. Das wusste man im Gerichtssaal zu Florenz. Wie man auch wusste, dass Baldassare Cossa sich mit der Einberufung des Konzils von Pisa so verdient gemacht hatte wie mit der Einberufung des Konstanzer Konzils und wie mit seinem großzügig selbstlosen Rücktritt als Papst. Drei gewaltige Anstrengungen mit dem einen, höchst ehrenwerten Ziel, das Große Abendländische Schisma zu beenden, um der Mutter Kirche wieder zu geordneten Verhältnissen und neuem Ansehen zu verhelfen.
„So einen Mann wie Baldassare Cossa zu ermorden, das ist schlimmer als die Stadt Rom zu zerstören“, fügte der Ankläger nach einer kurzen Pause mit großer Verzweiflungsgeste an sein Plädoyer an, „weit schlimmer! Das sollte bei der Urteilsfindung bedacht werden!“
Es wurde immer unruhiger im Saal. Wogegen der Vorsitzende Richter aber nicht einschritt. Er schien die Aufgeregtheit der Leute sogar zu genießen. Verständlich. Gab sie ihm und dem Urteil, das er fällen würde, doch nur zusätzliche Bedeutung. Deshalb kein Ordnungsruf, auch kein Griff nach der Handglocke auf seinem Tisch, falls er so was vor sich stehen hatte. Wer weiß das heute noch. Wohl aber weiß ich, dass ich das Verfahren so nicht weiter ablaufen lassen darf. Die beiden Angeklagten, diese armen Kerle, von der Folter gezeichnet, dazu Ausländer, die vermutlich nicht alles verstanden hatten, was der Ankläger ihnen vorwarf, die aber die Wucht gefühlt hatten, mit der sie fertiggemacht wurden, die deshalb wie in sich geschrumpft dastanden, ich kann sie nicht so ohne jede Hilfe ihrem Schicksal ausliefern.
Also trat ich kurz entschlossen an ihre Seite. Nach der feurigen Anklagerede hatte ich als ihr Verteidiger natürlich einen schweren Stand. Alles sprach gegen die Angeklagten, vor allem ihr Geständnis. Dazu auch das hohe Ansehen des Ermordeten. Und doch musste ich zunächst versuchen, das Bild des toten und meiner Meinung nach nur angeblich ermordeten Baldassare Cossa weniger hoch zu hängen.
„Wenn der Kardinalbischof von Tusculum tatsächlich zum Opfer eines Mordanschlags geworden wäre“, so mein Hauptargument, „dann müsste auch die Motivation der Täter berücksichtigt werden, die hier als Angeklagte stehen. Sie hätten dann als Kreter lediglich Vergeltung geübt, wie es ihre Pflicht war. Nämlich Vergeltung für den Mord, den Baldassare Cossa am 3. Mai des Jahres 1410 begangen hatte, und zwar an ihrem Landsmann, dem von Kreta stammenden Petros Philarghis, der Papst Alexander V. war. Denn Baldassare Cossa hat diesen Papst mit Gift bei einem von ihm veranstalteten Gastmahl im Kloster …“
„Dieser angebliche Mord steht hier nicht zur Verhandlung an“, unterbrach der Vorsitzende Richter mich mit erstaunlicher Entschiedenheit. „Zumal es überhaupt nichts gibt, was beim Tode des Heiligen Vaters Alexander V. prima vista für einen Mord spräche. Konsequenterweise ist deshalb auch nie ein Untersuchungsverfahren oder gar ein Gerichtsverfahren gegen Baldassare Cossa angestrengt worden. Hier und heute geht es nur um die beiden Angeklagten Brüder di Kreti. Und dazu ist abschließend festzustellen: Der Vertreter der Anklage hat ebenso wie der Fremde, der sich hier zum Verteidiger der beiden Verbrecher aufgeschwungen hat, sein Plädoyer gehalten. Damit ist den strengen Anforderungen der Prozessordnung Genüge getan. Das Gericht wird zu gegebener Zeit den Termin für eine weitere Verhandlung oder die Urteilsverkündung bekannt geben. Die Sitzung ist geschlossen.“
Damit ließ der Richter die aufgeregten Zuhörer allein. Er überließ sie ihrer Wut und ihren Rachegelüsten und der Unsicherheit, ob das Oberste Gericht des Stadtstaates Florenz die Weisheit und die Kraft haben werde, das scheußliche Verbrechen zu ahnden, mit dem ihnen der hoch angesehene und liebevoll verehrte Kardinalbischof Baldassare Cossa geraubt worden war.
Nun galt es zu warten, zu warten und zu warten. Womit das Geschehen, die angebliche Ermordung des Kardinalbischofs Baldassare Cossa, über die ein Urteil gefällt werden sollte, sich weiter und weiter entfernte und dabei mehr und mehr von der ewig rieselnden neuen Gegenwart zugeschüttet wurde. Damit erwies sich das Präsens, dieses sich ständig neu und immer noch etwas aufdringlicher kleidende Aktuelle, wieder einmal als stärker als das scheinbar so vollkommene Perfekt.
Die Gegenwart ist Tag für Tag der Sieger. Obwohl das Präsens doch nur immer einen lächerlich kurzen Lidschlag lang existiert, nämlich in dem Augenblick, in dem Zukunft in Vergangenheit verwandelt wird. Deshalb schlage ich mich auf die Seite des Verlierers und halte ich mich an die Vergangenheit.
2.
Heute kam ich wieder an den fünf Steinen mit der Plakette vorbei. Am Rheinufer auf dem Lindenhof in Mannheim. Etwa auf halber Strecke zwischen Stromkilometer 342 und 343. Diese Quader erinnern an die ehemalige Zollburg, die Burg Eichelsheim, die auch Münzstätte und Prominentenverlies war. Viermal zerstört, dreimal wiederaufgebaut und dann bis auf diesen mickrigen Rest verschwunden. Die Existenz dieser Burg war ein wildes Hin und Her gewesen, mit viel Lärm und viel Schweiß. Doch dann Ende des großen Trictrac-Spiels. Rien de va plus, the game is over. Ein abgeräumtes Spielbrett, gerade nur noch fünf Steine sind liegengeblieben,
Diese Steine erinnern mich an den Papst, der mehr oder weniger freiwillig von seinem hohen Amt zurückgetreten war, Johannes XXIII., der danach eingekerkert wurde, die meiste Zeit hier am Rheinufer in dieser Wasserburg. Sicher weggeschlossen als ein gefährlicher Schwerverbrecher.
Doch diese letzten Steine der Zollburg Eichelsheim dürften es besser wissen. Vielleicht verraten sie mir, was man bisher nicht weiß über den plötzlichen Tod von zwei Männern, die immerhin so wichtig waren, dass sie beide die Tiara getragen haben. Diese Steine müssen erfahren haben, wie der plötzliche Tod am 3. Mai des Jahres 1410 des zu höchster Bedeutung aufgestiegenen Mannes aus Griechenland, Petros Philarghis, Papst Alexander V. genannt, zu erklären ist, genau wie neuneinhalb Jahre später der überraschende Tod seines Nachfolgers, Baldassare Cossa, Papst Johannes XXIII. genannt, den man hinter vorgehaltener Hand als seinen Mörder verdächtigte.
Immerhin hat dieser Mann Baldassare Cossa, der aus einer reichen neapolitanischen Adelsfamilie stammte und sich als Papst Johannes XXIII. genannt hat, zweimal ein Konzil einberufen, um seiner zerfledderten Kirche den Schritt zu wieder geordneten Verhältnissen zu ermöglichen. Das Konzil von Pisa hatte er sogar selbst finanziert. Er hat hervorragende Männer zu Kardinälen gemacht, um der Kirche wieder auf die Füße zu helfen. Und immerhin hat er mehrfach den Verzicht auf die Papstwürde erklärt, aus Rücksicht auf die Schwierigkeiten seiner Kirche. Und doch musste er annähernd vier Jahre Gefangenschaft erleiden und schließlich auch noch ein extrem hohes Lösegeld für seine Freilassung zahlen. Und konnte sich nicht mehr dagegen wehren, dass die katholische Kirche ihn später als einen leeren Fleck in der Geschichte ihrer Päpste abgetan hat, als bloßen Gegenpapst, der nicht zählt. Obwohl die Kirche andere Gegenpäpste durchaus gelten lässt. Eine himmelschreiende Ungerechtigkeit. Zweifellos. Aber gegen das Urteil der Geschichte gibt es keine Beschwerdeinstanz.
So konnte in neuerer Zeit, im Jahre 1958, der zum Papst gewählte Kardinal Angelo Giuseppe Roncalli, sich sogar Papst Johannes XXIII. nennen. Als habe es den nicht schon gegeben. Als habe der nicht hier gelebt, in meiner Nähe. Etliche Jahre lang als Gefangener in der alten Zollburg Eichelsheim eingeschlossen. Ein Leben, das für Jahre einfach ausgelöscht wurde, und dann auch noch in der Erinnerung der Menschen. Diese Form der Missachtung eines Menschen entsprach einer uralten Tradition von härtester Bestrafung, nämlich der Damnatio memoriae, die trotz ihres lateinischen Namens jüdischen Ursprungs ist. Die alten Israeliten wussten, das Ich ist uns Menschen das Allerwertvollste, weshalb man einem Menschen nichts Schlimmeres antun kann, als sein Andenken auszulöschen. Auch ägyptische Pharaonen waren eifrig im Namenauslöschen von Vorgängern tätig. Tutanchamun wäre es beinahe gelungen, das Andenken an Echnaton, den Gründer der neuen Ein-Gott-Religion, ganz zu tilgen. Zum Glück nur beinahe. Im Falle Baldassare Cossa ist das ebenfalls nicht gelungen. Er bleibt als Papst Johannes XXIII. der Erste im Gedächtnis. Deshalb wird die römisch-katholische Kirche sich eines Tages gezwungen sehen, den Papst von 1958 unter der Bezeichnung Johannes XXIII. der Zweite in ihren Annalen zu führen.
Aber nur nicht zu weit vorgreifen. – Es geht um den Rücktritt eines Papstes, also um ein ungewöhnliches Ereignis, das damals für weltweite Aufregung gesorgt hatte. Als ob das Kommen und Gehen der Jahrhunderte ihm nichts anhaben könnte, dem kindlichen Glauben an die wundersamen Heilsgeschichten voller Sex und Verbrechen, die vor zweitausend Jahren im vorderen Orient zu einer neuen Glaubensgewissheit zusammengeschmolzen wurden und irgendwann uns übergestülpt worden sind. Als eine Religion, die uns einen Stellvertreter Gottes auf Erden präsentiert. Eine Nummer kleiner ging es nicht. Oder geht es in Wahrheit gar nicht um diese alten Geschichten der Bibel, die man hochtrabend das Buch der Bücher nennt? Geht es in Wahrheit um das, was noch viel älter ist und das wir als das Menschliche oder das Allzumenschliche umschreiben? Geht es nicht einfach nur um den Fluch des Ichs?
Wieder einmal stehe ich hier am Rheinufer und lasse mir das längst vergangene Geschehen im Gerichtssaal zu Florenz durch den Kopf gehen. Ich kann es mir gut vorstellen und lasse es fließen, wie das Wasser des Rheins vor mir dahinfließt. Stehe hier, wie in eine andere Zeit verbannt, und starre die fünf Steine an und warte darauf, dass sie mir verraten, was damals geschah, vor sechshundert Jahren. Und schon glaube ich im Hof dieser quadratisch angelegten Burg zu stehen, deren kümmerliche Reste ich vor mir sehe. Plötzlich selbst in dem engen Mauerkarree, das man Burg Eichelsheim nannte. Ein anderer Name für den scharfkantigen Bau war Veste Mannheim, wie ich gehört habe. So genannt nach dem recht unansehnlichen Fischerdörfchen Mannheim in der Nähe, nur wenige Ruderminuten den Rhein abwärts, wenn auch für die Burgleute außer Sichtweite und ohne jede Bedeutung. Außerhalb der hohen Burgmauer, die mich umgibt und über die ich nicht hinwegsehen kann, ist ein Wassergraben, durch den das geschickt abgeleitete Rheinwasser fließt, das die Zollburg zur Wasserburg macht. Den breiten Graben überspannt bloß eine einzige Brücke, die an der Nordseite in den dichten Wald von Eichen führt, der die Burg umgibt. Nichts anderes rundum als Eichen und an der Westseite der zügig dahin fließende Rhein.
Doch ich will noch nicht über die Brücke gehen. Ich will in der Burganlage verweilen. Hinter mir den dreigeschossigen Wohnbau, mit der burgeigenen Kapelle, vor mir in der Nordwestecke den sogar noch etwas höheren viereckigen Wachtturm mit spitzer Haube, in dem der zurückgetretene und zusätzlich auch noch abgesetzte Papst Johannes XXIII. gefangen gehalten wird.
Ein Mann von imponierender Gestalt, massig und einen ganzen Kopf größer als in seiner neapolitanischen Heimat üblich. Das kennt man ja, dass die imponierende Gestalt zur beherrschenden Stellung verhilft. Die Geschichtsbücher sind voll von solchen Beispielen. Doch jetzt sehe ich den Papst Johannes XXIII. mit ständig geneigtem Haupt, nicht aus Demut, sondern weil die bescheidenen Dimensionen des Turms ihm keinen aufrechten Gang erlauben, wenn er in seinem Turmgefängnis von dem einen Raum, in dem er schläft, in den anderen geht, in dem er die endlosen Stunden der Wachheit verbringen muss. Oder wenn er sich nach nebenan in die enge Aborthutzel begibt, die wie außen an den Turm angeklebt über dem Burggraben hängt. Gar nicht zu reden von dem zu kurzen Bett, in dem er nur verkrümmt schlafen kann. Ein größeres Bett zu bekommen, ist ihm nicht gelungen. Abgelehnt. Man hat ihm auch seine Bitte glatt abgeschlagen, Familienangehörige und seinen Leibdiener sowie den Koch und den Barbier mit in diesem Gefängnis zu haben.
Lediglich sein Kaplan, der gleichzeitig sein Beichtvater ist, lebt in seiner Nähe, der alte Don Antonio aus Florenz, der aber nicht mit im Turm eingeschlossen ist, weil er kein Gefangener ist, sondern in dem breiten Wohnbau gegenüber seine Kammer hat, gleich neben der Kapelle. Dort kann er auch täglich seine Messe lesen. Anders als Johannes XXIII., dem man es nicht gestattet, sein Turmgefängnis zu verlassen und in die Burgkapelle zu gehen. Er hat sich in seiner Zelle aus einem Tischchen und seinem vergoldeten Umhängekreuz einen behelfsmäßigen Altar gebaut, vor dem er gelegentlich die heilige Messe feiert. Wenn ihm mal danach ist. Er ist allein, wenn nicht Don Antonio zu ihm herüberkommt. Der hat als der Seelsorger des abgesetzten Papstes eine etwas bessere Unterkunft und die Erlaubnis, den ehemaligen Papst jederzeit zu besuchen. Deswegen hat der gefangene Papst seinen Kaplan und Beichtvater auch gleich noch zu seinem Barbier und zu seinem Vorkoster bestellt. Weiß er doch, wie gefährlich es für einen Mann von Bedeutung ist, eine fremde Hand mit dem Rasiermesser an seinen Hals zu lassen, genau so gefährlich wie auch nur einen Bissen oder einen Schluck zu sich zu nehmen, der nicht geprüft ist.
Im Übrigen aber ist der prominente Gefangene im Turm dieser feuchtkalten Burg nur unter Fremden. Umgeben von dem kurpfälzischen Wachpersonal, einfachen Leuten, die kein Wort seiner Sprache verstehen, wie er kein Wort von dem versteht, was sie sagen. Wahrhaftig ein Aufenthalt zum Verzweifeln für einen Mann, der Geld und Bedeutung hatte und seiner eigenen Schutztruppe sowie seinem eigenen Hofstaat zu befehlen gewohnt war. Wie ist er nur in diese Situation geraten? – Sprecht es aus, Steine, verratet es mir! Nur keine falsche Scham, nur keine übertriebenen Rücksichten! Ihr dürft sprechen, Euch wird man nichts zuleide tun wegen eurer Offenheit.
3.
Wir waren nicht nur zu fünft, nein, wir waren Tausende. Sauber kantig behauene Quader aus Neckartaler Buntsandstein. Ja, zwar in einem schlichten Einheitsdress, aber wie mit feierlichem Purpur überhaucht, waren wir angetreten. Sand sollen wir dereinst gewesen sein, also der Urstoff an sich, aber das war, bevor die Erde uns in beinahe endlos währender heißer Umarmung geformt hat. Bevor sie uns so perfekt gestaltet hat, dass wir keinen Druck mehr spüren, dass keine Hand mehr stark genug ist, uns zu beugen, und zwei Männerarme uns nicht anheben können, dass zudem kein Auge erspähen kann, was hinter uns geschieht, auch kaum ein Ton uns durchdringen kann.
So wurden wir die Zollburg Eichelsheim, an der rechten Flanke des Rheins. Hart am Ufer. Da, wo der vom Bodensee heranströmende Rhein sein wildes Schlingern einmal unterbrochen hat und ein Stück weit schön geradeaus durch die Ebene fließt, so dass man vom Turm der Burg aus die Kähne und Flöße schon von weitem sehen kann, die sich auf Bergfahrt oder auf Talfahrt der Burg nähern. Wichtig für die in Heidelberg residierenden Pfalzgrafen und Kurfürsten bei Rhein, die hier am Rheinufer ihre schwere Hand auf die Fracht der Händler legten und erbarmungslos Akzise einstrichen. Eine unverschämt hohe Abgabe, unausweichlich, von jedermann allein für das Recht zu zahlen, Handelsgut durch Kurpfälzer Hoheitsgebiet zu transportieren, den Rhein hinab wie den Rhein hinauf. Wer vom obersten Fenster unseres Turmes seinen Blick über den Rhein gleiten ließ, der sah es heranschwimmen, das Geld. Und wie eifrig es heranschwamm, das Geld, Geld, Geld, das den Menschen so viel bedeutete.
Zollburg allein, das reichte den Heidelbergern nicht. Wir wurden auch noch die Münzstätte der Pfalzgrafen, in der unter starker Bewachung der silberne Hohlpfennig geprägt wurde, der als Mannheimer Pfennig berühmt und begehrt war. Ja, zugegeben auch berüchtigt, weil er mit dem Bild der Straßburger Lilie fast genau so aussah, wie der überall am Oberrhein gehandelte Straßburger Pfennig, und viel zu oft mit ihm verwechselt wurde, aber weniger Silber enthielt. Daran hatten die listigen Pfalzgrafen dreist gespart. Das brachte was ein. Und auch dieses aus Falschmünzerei ergaunerte Geld hatten wir sicher zu beherbergen.
Schließlich wurden wir sogar noch zum Kerker für prominente Häftlinge, von denen die Pfalzgrafen hohe Lösegelder erpressten. Wir waren der Aufbewahrungsort im absoluten Abseits, unzugänglich durch die hohe Mauer und das uns umgebende Rheinwasser, dazu von einer genügend großen Truppe bewaffneter Männer beschützt. Damit erlangten wir sogar Weltruhm.
Das heißt, wir waren von Anfang an nicht dem Luxus bestimmt, nicht dem Vergnügen und nicht der Landesverteidigung. Kein Jagdschloss und keine Kokottenremise, auch keine Abstellkammer für abgeschobene adlige Frauen und kein vorgeschobener Posten. Bei uns ging es um wichtigere Aspekte, um das Wichtigste überhaupt, nämlich um Geld. Diesem Zweck haben wir in der einen wie in der anderen und der dritten Funktion zuverlässig gedient. In Treue fest, wie es für uns Steine seit jeher selbstverständlich ist. Dass man hinterher unsere wohlgefügte Gemeinschaft zerstört hat, so rücksichtslos und gründlich, dass nur noch wir fünf Steine übrig geblieben sind, das ist der Undank der Welt. Aber wenn wir jetzt auch nur noch ein kleines Fähnlein sind, so halten wir doch die Erinnerung an unsere großen Zeiten lebendig, vor allem das Andenken an unseren glamourösesten Gast, den Papst Johannes XXIII. – ehrlich.
Ja, ich weiß. ihr Steine, so lange ihr nackt bleibt, seid ihr ehrlich. Nur die mit Fahnen drapierten, die mit überlebensgroßen Bildern von Despoten verhängten und viel zu oft auch die zu Statuen gewordenen Steine, denen ist nicht zu trauen. Aber genug der Vorrede, ich höre:
VerkleinernProfessor Joachim Müller, Bad Krozingen, 3. Juni 2014 schreibt:Vielen Dank für den sehr interessanten NETzine-Newsletter, den ich mit großem Interesse gelesen habe. Ich habe auch schon das Buch vom Papst Johannes XXIII. “in der Mangel” und finde es sehr gut; der Schreibstil gefällt mir sehr, und ich freue mich schon auf das nächste Werk, den “Perkeo” !!!!!
Prof. Dr. Horst Krämer, Ulm 24. Mai 2014 schreibt:Betrifft: “Der Papst im Kerker“: Herzlichen Dank für den Papst im “Knast”. Das ist wieder ein wirklich gelungenes Werk. Das Einfühlungsvermögen des Autors ist phänomenal.
Horst Krichbaum, Ginsheim-Gustavsburg 29. 4. 2014 schreibt:Neben mir liegt „Der Papst im Kerker“. Ich habe ihn mir in Null Komma Garnichts hineingezogen und bedauert, dass er keine 300 Seiten lang ist … Meine Bewunderung zu Ihrem neuen Opus ! … Am ersten Johannes XXIII. hätte ich mich auch gern abreagiert … Ich hoffe auf baldige 2. und höhere Auflagen.
Elfi Weber, Heiligkreuzsteinach 16. April 2014 schreibt:Nach dem “Papst im Kerker” werde ich mir auch die anderen Laufenberg-Bücher reinziehen.
Guntram Erbe, Hilpoltstein 1. 4. 14 schreibt:“Der Papst im Kerker”, wunderbar. Das ist ja nicht das erste Laufenberg-Buch, das mich begeistert. Immer diese Verbindung von Geschichtlichem mit persönlichen Äußerungen des Autors, die Lebenserfahrungen zu Bonmots werden lassen, und all das eingepackt in eine lebhaft geschilderte Handlung, das ist eine Lektüre, die dem Fernsehen überlegen ist.
Vielen Dank für das neue Buch “Der Papst im Kerker“. Ein interessantes Thema aus einem ungewöhnlichen Blickwinkel.
 “Bei Johannes XXIII. denkt man an den freundlichen katholischen Oberhirten, der mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil frischen Wind in die Kirche brachte. Indem Angelo Roncalli nach seiner Wahl 1958 diesen Papstnamen wählte, war die Auslöschung seines mittelalterlichen Namensvorgängers perfekt. Als Papst 1415 auf dem Konzil von Konstanz abgesetzt, zählte Baldassare Cossa seither in der Römischen Kirche nicht mehr.
“Bei Johannes XXIII. denkt man an den freundlichen katholischen Oberhirten, der mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil frischen Wind in die Kirche brachte. Indem Angelo Roncalli nach seiner Wahl 1958 diesen Papstnamen wählte, war die Auslöschung seines mittelalterlichen Namensvorgängers perfekt. Als Papst 1415 auf dem Konzil von Konstanz abgesetzt, zählte Baldassare Cossa seither in der Römischen Kirche nicht mehr.
Diesen ersten Johannes XXIII. zeigt Walter Laufenberg in seinem Buch „Der Papst im Kerker“ in einem anderen Licht als die Chronisten, die Cossa als unwürdigen Gegenpapst abhandeln. „Gegen das Urteil der Geschichte gibt es ja keine Beschwerdeinstanz“, liest Laufenberg mit feiner Ironie beim literarischen „Jour Fixe“ des Internationalen Bodensee- Clubs (IBC) auf der Meersburg. Um seine Version zu erzählen, lässt der Autor die übrig gebliebenen fünf Steine der Zollburg Eichelsheim bei Mannheim sprechen, auf der Cossa nach seinem Sturz vier Jahre gefangen gehalten wurde. Laufenberg wohnt ganz in der Nähe und machte eigens für den Jour fixe die rund 300 Kilometer lange Reise an den See, die Cossa in die andere Richtung zurücklegen musste, 600 Jahre früher, unfreiwillig und ungemein strapaziöser als Laufenberg.
„Cossa war kein Engel. Damals konnte man als Engel nichts werden und heute wahrscheinlich auch nicht.“ Das räumt Laufenberg auf Nachfrage von IBC-Mitglied Chris Inken Soppa ein, die auf den durchaus zwielichtigen Charakter des Gegenpapstes hinweist. Soppa veröffentlicht im selben Verlag wie Laufenberg und als sie von seinem Papst- Buch hörte, holte sie ihn, passend zum Konzilsjubiläum, an den See. Laufenberg ist nicht das erste Mal auf der Meersburg, er kennt die Region gut. Vor Jahren kam er in Kontakt mit Wilderich Graf von Bodman, der ihm sein Archiv öffnete. Daraus entstand Laufenbergs Buch „Stolz und Sturm“ über den Bauernaufstand am Bodensee 1524. „Es ist alles historisch, bis auf die kleinen Leute, die ja nicht in Geschichtsbüchern auftauchen“, sagt Laufenberg.
Er hinterfragt kontinuierlich offizielle Geschichtsversionen, das zeigt sich auch im dritten Buch, das er vorstellt: „Denk ich an Bagdad in der Nacht“: Laufenberg gehört zu einer Handvoll deutscher Journalisten, die unmittelbar vor dem Irak-Krieg 2003 einer Einladung Saddam Husseins ins Land folgen. Intensive Kontakte mit Irakern sind aufgrund des straffen Programms kaum möglich, doch die menschlichen Begegnungen prägen sich ein, dem Autor wie dem Zuhörer. Und unwillkürlich zeichnen sich Parallelen ab über Jahrhunderte hinweg: Sowohl Cossa und Hussein waren zweifellos Schuldige. Aber in beiden Fällen benutzten ihre Gegner auch schamlos Propaganda-Lügen, um den Sturz der ehemals Mächtigen – und Verbündeten – zu rechtfertigen.”
Autor Walter Laufenberg kam aus Mannheim zum literarischen Jour Fixe auf die Meersburg.
Chris Inken Soppa, die Laufenberg auch vorstellte, hatte ihn im Namen des Internationalen Bodensee-Clubs eingeladen.

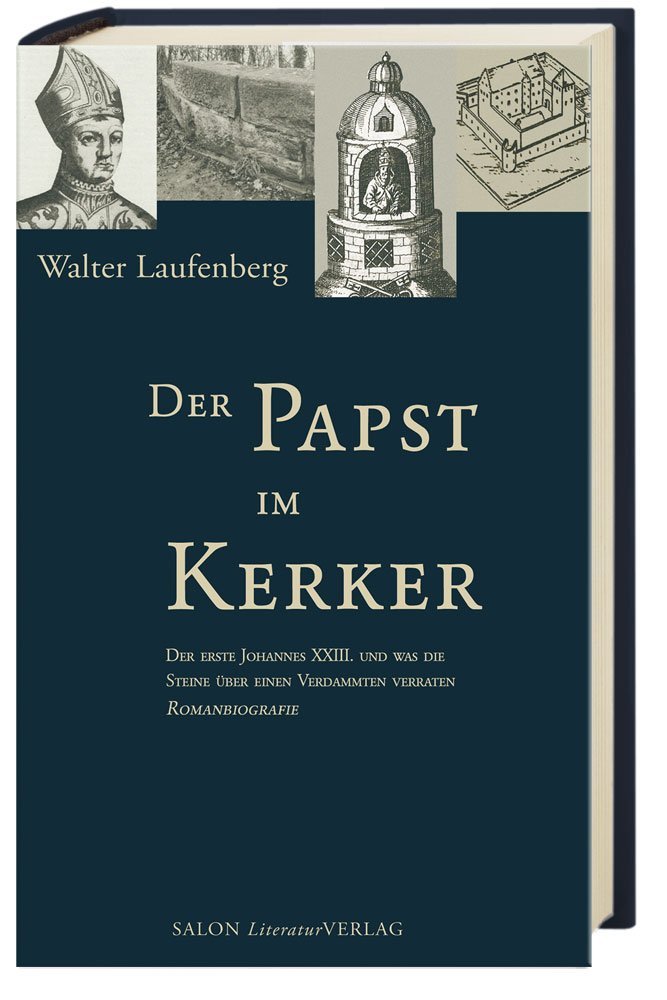











































 Der Computer Doktor in Mannheim
Der Computer Doktor in Mannheim