(Festrede, gehalten in Otterndorf an der Elbmündung am 2. April 2006 als Ehrenmitglied des Otterndorfer Shantychors anläßlich des 175. Geburtstags der Otterndorfer Liedertafel von 1831, heute Otterndorfer Shantychor)
Das war am Morgen des 1. Mai des Jahres 1995. Da sah ich draußen bei der Tankstelle eine Horde Männer in Fischerhemden und mit roten Tüchern um den Hals und dem Elbsegler auf dem Kopf bei der Arbeit. Sie errichteten einen riesigen Maibaum. Die aufgekrempelten Hemdsärmel zeigten mir imponierend kräftige Arme. Typisch Seemann, verstand ich. Und als der Maibaum dann stand und die Männer sich zum Chor gruppierten und lossangen, da stand ich dahinter und habe leise mitgesungen. Denn die Lieder kannte ich fast alle. Hatte ich doch jahrelang neben meinem Bruder am Klavier gestanden und gesungen, wenn er Volkslieder und Seemannslieder spielte.
Als der Chor eine Pause machte, ging ich zu dem Chorleiter und sagte, daß ich für fünf Monate Otterndorfer Bürger sei, als der neue Stadtschreiber, und deshalb gerne wüßte, ob ich in dem Chor mitsingen dürfte. Der Dirigent ging mit mir zum Vorsitzenden und sagte: „Hier ist einer, der mitsingen will.“ Der Vorsitzende sah mich an und fragte: „Wie heißt du denn?“ Und ich antwortete brav: “Walter Laufenberg.“ „Dann begrüße ich dich als unseren neuen Sangesbruder Walter.“ Und mit kräftigem Handschlag: „Mein Name ist Wolfgang.“ So hatte ich Dieter Kirchner und Wolfgang Zinow kennengelernt. Damit hatte ich gleich einige Dutzend neue Freunde.
Wie ich schnell erfuhr, kamen sie aus allen möglichen Berufen. Sie sangen mit großer Begeisterung Seemannslieder, sahen auch wie Seeleute aus, waren aber keine. Sie waren verkleidete Landratten. Und ruck-zuck bekam auch ich eine Seemannskluft verpaßt und war plötzlich genauso eine verkleidete Landratte. Da habe ich mich gefragt: Was soll das?
Ich war meine fünf Monate lang jeden Mittwoch-Abend bei der Probe und auch bei einigen öffentlichen Auftritten dabei, sogar bei dem großen Wettbewerb der Shantychöre in Cuxhaven, bei dem wir erfolgreich abgeschnitten haben. Ich habe als großer Sänger meinen Beitrag dazu geleistet, weniger von der Stimme her als von meinen Einmeterneunzig. Und als ich dann Anfang September hier ein Stadtschreiberfest veranstaltete, zu dem rund fünfzig Freunde aus allen Ecken Deutschlands kamen, war der Otterndorfer Shantychor mit dabei. Mit seinen Liedern und mit seinem Durst. Und ich war stolz, meinen alten Freunden die neuen Freunde vorstellen zu können und umgekehrt. Eine ganze Reihe von Chormitgliedern hatte ich inzwischen intensiver kennen und schätzen gelernt. Der Otterndorfer Shantychor hat entscheidend dazu beigetragen, daß ich über meinen Sommer im Gartenhaus am Süderwall sagen kann: Das war eine wunderbare Zeit. Das Buch, das ich über meine Stadtschreiberzeit geschrieben habe, hieß „Das Lusthaus“. Es ist pünktlich zu meinem Abschied erschienen, im Niederelbe-Verlag. Darin hatte ich natürlich auch die Otterndorfer Liedertafel von 1831 erwähnt.
Das alles ist jetzt fast 11 Jahre her. Ich hatte also viel Zeit, mir selbst die Frage zu beantworten: Was soll das mit diesen verkleideten Landratten? Und ich bin froh, daß der Otterndorfer Shantychor mir jetzt zu seinem Jubiläum die Gelegenheit gegeben hat, öffentlich zu gestehen, warum ich mich unter den verkleideten Landratten so wohlgefühlt habe.
Die dicke Mappe mit den Liedern, die der Chor mir zum Abschied geschenkt hatte, brachte mich dazu, die Liedertexte einmal aufmerksam zu lesen. Ein Shanty ist ja nicht nur Musik, ein Shanty ist auch ein Stück Literatur. Beispielsweise das Gedicht des Schriftstellers und Literatur-Professors Klaus Groth: „Ik wull, wi weern noch kleen, Jehann.“ Von ihm stammt übrigens auch das unvergeßlich schöne Gedicht: „Lütt Matten de Has.“ Beim Lesen der Shantys, dieser literarischen Spezialitäten, wurde mir klar: Das sind Gedichte, die jeden von uns betreffen.
Sie erinnern uns daran, daß in früheren Zeiten Seeleute beinahe die einzigen waren, die immer mal wieder für längere Zeit in der weiten Welt unterwegs waren. Alle anderen arbeiteten daheim in der Fabrik, der Werkstatt, dem Laden oder auf dem Hof. Heute dagegen ist beinahe jeder zeitweise weg von daheim, ob auf Montage oder in Fortbildung, im Auslandseinsatz, auf Handelsreise oder – wie ich – im Gartenhaus am Süderwall. Seemann oder nicht Seemann, das ist heute eine Sache des Gefühls. Denn in jedem richtigen Mann lebt und singt ein bißchen Seemann immer noch als atavistische Erinnerung mit.
In beinahe jedem Beruf muß man heute irgendwann wildentschlossen sagen: „Leinen los, Schiff ahoi auf großer Fahrt.“ Und immer bitten wir: „Liebes Mädel, laß das Weinen.“ Oder wie der Schriftsteller Bruno Traven in dem Shanty sagt, das er seinem berühmten Roman „Das Totenschiff“ vorangesetzt hat: „Mädel, heul doch nicht so sehr, wart auf mich am Jackson Square im sonn’gen New Orleans.“ Und immer können wir damit protzen: „Wir seh’n die ganze Welt.“ Beim Abschied betonen wir noch, daß wir auch treu sein können: „Wir gehören zusammen, wie der Wind und das Meer.“ Sind wir dann fern der Heimat, gelingt es zunächst noch uns einzureden, daß wir so tolle Kerle sind, für die die Ferne die eigentliche Heimat ist: „Denn die wahre Heimat der Matrosen, das ist der weite Ozean.“ Richtig. Die Erfahrung hat jeder schon gemacht: Erst erlebte und überstandene Abschiede machen uns zu reifen Menschen.
Der weite Ozean ist allerdings nur viel Wasser und harte Arbeit. Man sollte sich klarmachen, daß der Ozean nur ein Codewort ist, das für all die Namen steht, die einem schon als Junge was bedeutet haben. „Einmal noch nach Bombay, einmal nach Shanghai, einmal noch nach Rio, einmal nach Hawaii, nach Hawaii. Einmal durch den Suez und durch den Panama.“ Dieses Lied hat der Dichter Hans Leip geschrieben, immerhin Sohn eines Hamburger Seemanns, unvergessen als Autor des Liedes „Lili Marleen“. Er hat die Namen mit dem Duft der großen weiten Welt beschworen, die in den Shantys besungen werden, auch Singapur, Jamaika, Java, Madagaskar, San Franzisko oder Alaska.
Lebt man gerade berufsbedingt in der Fremde und versinkt im Meer von Arbeit, dann denkt man intensiver an die Liebste, die man zurückgelassen hat, und stellt sich vor: „Der Nachtwind singt für sie das Lied vom Glück.“ Was ja auch schon was ist. Oder man ruft in die Weite: „Antje, Antje, hörst du nicht von ferne das Schifferklavier? Antje, Antje, das Lied soll dich grüßen von mir.“ Oder man denkt erst einmal an sich und tröstet sich damit: „The winds have gone over the ocean and brought back my Bonnie to me.“ Wem der Wind zu unzuverlässig ist, der schickt was Lebendiges nachhause: „Falle ich einst zum Raube empörtem Meer, fliegt eine weiße Taube zu dir hierher.“ Der Anspruchsvollere schickt nicht, er empfängt lieber, nach der Devise: nehmen ist seliger als geben: „Kleine, weiße Möwe über Meer und Land, bringst uns einen Gruß vom fernen Elbestrand.“ Und der erfahrene Genießer spricht sich in der Ferne gut zu: „She waits for you!“ Für den simpleren Genießer genügen Hilfsmittel wie Whisky, Rum, Bier, Köm. Doch wenn er es übertreibt, kriegt er zu hören: „What shall we do with the drunken sailor?“ Nur ausnahmsweise geht es um edleres Gesöff, nämlich „In the Quartermaster’s store, there is wine, wine, wine, tonight we feel so fine.“
Doch wem das Genießen der großen Freiheit oder der Ferne überhaupt nicht gelingt, dem bleibt nur, sich immer wieder vorzusagen: „Mann, holl di stief! Mann, holl di stief!“ Oder er macht sich trotzig klar: „Das kann doch einen Seemann nicht erschüttern.“
Nun gibt es natürlich auch unter uns tollen Kerlen welche, die es ausnutzen, einmal von der Leine gelassen zu sein. Nach dem Motto: Freie Fahrt dem Tüchtigen. Die gewinnen und verlieren eine Geliebte nach der anderen und rechtfertigen das mit den Worten: „Das ist die Liebe der Matrosen. Auf die Dauer, lieber Schatz, ist mein Herz kein Ankerplatz. Es blüh’n an allen Küsten Rosen, und für jede gibt es tausendfach Ersatz.“ Immerhin ein renommierter Dichter, der einem diesen Persilschein ausstellt, nämlich der Berliner Schriftsteller und Librettist Robert Gilbert. Doch so ein kleines Liebesspiel unterwegs kann einem den gesamten Fahrplan durcheinander bringen, so daß man seufzt: „Denn wenn es heute Abend wird, fahr ich nicht nach Baltimore.“
Natürlich kann man dabei auch übel hereinfallen und an eine Herumtreiberin geraten, die einen ausnimmt, wie „a roving in Plymouthtown.“
Es gibt ja leider so vieles, das schiefgehen kann. Deshalb ist der Seufzer so berechtigt: „Let me go home, let me go home, I feel so break up, I want to go home.“ Und selbst der Erfolgreiche kennt nur ein Ziel: Nachhause. “Und legt ein Schiff aus Hamburg an, steht er am Kai und spricht: Nimm mich mit, Kapitän, auf die Reise! Nimm mich mit, denn ich kenne jetzt die Welt. Nimm mich mit, Kapitän, auf die Reise! Bis nach Hause, hier, nimm all mein Geld.“ Der bekannte Lyriker Fritz Grasshoff hat dieses rigorose Heimreise-Verlangen in Worte gefaßt. Heimweh gehört zum Fernweh wie Revers und Avers der Münze zusammengehören. Deshalb ist es verständlich, wenn in der Fremde das Lied erklingt: „Die Sonne, der Mond und die Sterne, die sehen wir kommen und geh’n, und träumen in endloser Ferne von Heimat und Wiederseh’n.“
Zugegeben, die Seefahrerromantik ist auf der Strecke geblieben, als die Liegezeiten im Hafen immer kürzer wurden und die Crewmitglieder aus immer mehr Ländern kamen, deren Sprache man nicht versteht. Die Arbeit auf den mit modernster Technik ausgerüsteten Schiffen hat sich grundlegend gewandelt. Der Mann im Mastkorb ist verschwunden, auch der Klabautermann. Die Barentsee ist nuklear verseucht. Das ist die neue Gefahr. Daneben die Kalaschnikow in der Hand von Piraten. Alles nichts zum Besingen.
Deshalb bleibt der Shanty bei der christlichen Seefahrt alter Prägung, bleibt beim Segeln. Der große Bewunderer der Segelschiffahrt war der Schriftsteller Gorch Fock, mit richtigem Namen Johann Kinau. Ihm hat der Schriftsteller und Arzt Traugott Freiherr von Stackelberg ein Denkmal gesetzt mit dem Gorch-Fock-Lied „Die hohen Masten und der schlanke Bug zieh’n immer wieder uns auf See.“ Ein Lied, das in keinem Shanty-Konzert fehlt.
Das heißt, wir bleiben bei der Segelschiffahrt, und wir halten fest am Singen bei der Arbeit. Und das mit Recht. Denn was sich nicht geändert hat, das ist zum einen die Sehnsucht nach der Ferne, zum anderen das schnelle Umschlagen in ihr Gegenteil, das Heimweh. Immer wollen wir ja das andere, das ist so menschlich. Die beiden Seiten der Medaille Sehnsucht, sie heißen Hinaus und Nachhaus. Sie sind es, die dem Shanty geradezu eine typische Struktur geben: In der ersten Strophe das Fernweh, in der zweiten die große Fahrt mit allerlei Erlebnissen und in der dritten das Heimweh, wie in dem Lied „Oh Bootsmann, Bootsmann, sag uns doch, wann gehen wir in See?“
Ist der Abenteurer dann endlich wieder daheim, kommt er seiner Liebsten gern mit der alten Ausrede: „Wenn im fremden Land ein roter Mund mir zugelacht, habe ich an dich, mein Mädel, nur an dich gedacht.“ Wenn er Glück hat, glaubt sie ihm das. Andernfalls könnte es sein, daß sie ihn zum Verzicht auf die nächste große Fahrt drängt. Dann sitzt er bald „auf der alten Rentnerbank am Otterndorfer Hafen“ oder „in der Kneipe am Moor“, wo ihm nur noch bleibt zu singen und zu spielen. „Und der Klang läßt die Männer lauschen.“
Diese Männer, die den Klängen lauschen, das sind wir, die als Seeleute verkleideten Landratten genau wie die nicht verkleideten. Denn der Shanty, gleich ob auf Hochdeutsch oder Plattdeutsch oder Englisch gesungen, er faßt ein allgemeines männliches Lebensgefühl in Worte. Der Shanty ist das Lied des Mannes, der allen Bindungen zum Trotz noch nicht total domestiziert ist. Und wenn schon Verkleidung, wenn wir schon in einem Bild darstellen wollen, was unser Leben ist, dann ist der Seemann die passende Parabel. Nicht der Clown, der Harlekin. Viel zu pessimistisch, dieses lachende Gesicht des tieftraurig Wissenden. Auch nicht der Vagabund, viel zu überlegen und zu unbekümmert, zu verantwortungslos. Nein, der Seemann ist die passende Darstellung unseres Lebensgefühls: Arbeiten, zuverlässig arbeiten und singen und einen heben und sich doch immer nach etwas anderem sehnen. Und deshalb ist der Shanty unser Lied, meine Herren. Von den Damen will ich in dem Zusammenhang nicht sprechen, die sind ja ganz anders. Aber wir, wir sind halt so: Immer voller Sehnsucht nach der Ferne, auch arbeitswillig und kameradschaftlich, manchmal auch viel zu durstig, dabei doch immer voller Heimweh. Und gerade deshalb gefallen wir Ihnen, meine Damen. Denn Sie sind ja unsere Heimat.


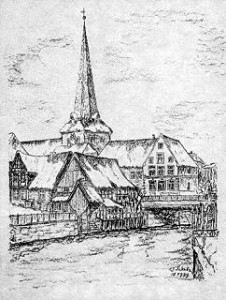











































 Der Computer Doktor in Mannheim
Der Computer Doktor in Mannheim